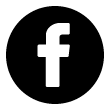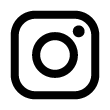Den Landkreis gemeinsam gestalten
Veränderungen sozial gerecht managen
Das Leben der Menschen im Landkreis Leipzig ist aktuell geprägt von den Auswirkungen der multiplen Krisen in der Welt; von den Folgen der globalen Erwärmung mit ihren Auswirkungen auf das Leben und auf die Wirtschaftsstruktur im Landkreis; vom Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine mit den Auswirkungen auf das persönliche Sicherheitsempfinden des Einzelnen und die Aufgaben und Belastungen für die Unterstützung der Ukraine; vom demographischen Wandel, mit der schwierigen Suche nach Mitarbeitenden in vielen Betrieben, aber auch in den Behörden und der Frage, wie unsere soziale Infrastruktur daran angepasst werden kann.
Dies alles passiert im Landkreis gleichzeitig und doch höchst unterschiedlich. Wir nehmen wahr, dass in etlichen Kommunen, vor allem dicht am Stadtrand Leipzigs, Kindergärten, Schulen etc. die Nachfrage von jungen Familien kaum decken können, während in peripheren Bereichen des Landkreises die Alterung und Schrumpfung der Einwohnerschaft zunimmt und dies zu ganz anderen Problemen führt, wenn sich die Frage stellt, welche Infrastruktur ist noch erforderlich und kann aufrecht erhalten werden.
In diesen Spannungsfeldern verlieren zunehmend mehr Menschen die Orientierung und der Wunsch nach einfachen Lösungen für komplexe Aufgabenstellungen wird stärker. Wir als SPD im Landkreis wollen auch weiterhin diesen einfachen Lösungen entgegentreten, die allzu oft auf Kosten von Schwächeren in der Gesellschaft gesucht werden. Wir stehen vielmehr weiterhin dafür ein, dass sich möglichst viele Menschen aktiv an der demokratischen Auseinandersetzung bei der Suche nach den besten Lösungen für all diese Themen beteiligen.
Für die politische Arbeit im Landkreis Leipzig wollen wir uns in den nächsten Jahren auf folgende Themen konzentrieren, ohne dabei die weiteren Aufgaben aus dem Blick zu verlieren:
Was wir wollen: Wir wollen, dass die milliardenschweren Investitionen des Bundes gerecht verteilt werden und auch den Landkreis Leipzig erreichen – z. B. bei der „Troglösung“ an der Agra-Brücke. Auf Landesebene braucht es eine Reform des Vergaberechts, weniger Bürokratie und gleichzeitig klare soziale und ökologische Standards. Außerdem fordern wir Bildungsfreistellung, Investitionen in erneuerbare Energien und eine aktive Fachkräftestrategie mit Zuwanderung.
Warum das wichtig ist: Nur mit Investitionen in Infrastruktur, Arbeit und Ausbildung bleibt unser Landkreis zukunftsfähig. Fachkräftemangel, steigende Strompreise und drohende Betriebsschließungen gefährden Arbeitsplätze und Lebensqualität. Mit klaren Konzepten für Industrie, Handwerk und Energiewende sichern wir Beschäftigung und gestalten die Region nachhaltig.
Was wir wollen: Wir wollen Ausbildung, Weiterqualifizierung und gesteuerte Zuwanderung in einem Landesprogramm bündeln. Schnelle Anerkennung von Abschlüssen und Willkommensstrukturen müssen sichergestellt werden.
Warum das wichtig ist: Der demografische Wandel macht Sachsen bis 2030 zum Importeur von Arbeitskräften. Integration und Vielfalt sind entscheidende Standortfaktoren im internationalen Wettbewerb.
Was wir wollen: Wir streben Spielräume für Zukunftsinvestitionen durch einen Transformations- und Infrastrukturfonds an. Dabei soll die Landesverfassung unberührt bleiben.
Warum das wichtig ist: Ohne neue Kredite bleiben Bundesmittel ungenutzt und der Investitionsstau wächst. Gutachten zeigen verfassungskonforme Modelle für Fonds-Lösungen.
Was wir wollen: Wir wollen ein landesweites Förderprogramm schaffen, das Kommunen, Kleinvermieter*innen und Genossenschaften beim Reaktivieren leerstehender Was wir wollen: Das Land soll ein Programm zur Aktivierung von leerstehenden Wohnungen auflegen, das gezielt Kleinvermieter*innen unterstützt. Zuschüsse, Beratungsangebote und die Übernahme von Eigenanteilen bei Sanierungen sollen helfen, leerstehende Wohnungen wieder auf den Markt zu bringen.
Warum das wichtig ist: Gerade in ländlichen Regionen gibt es viel Leerstand, der wertvoller Wohnraum sein könnte. Viele kleine Eigentümer können Sanierungen aber nicht finanzieren. Mit gezielten Hilfen schaffen wir bezahlbaren Wohnraum, stärken die Ortskerne und nutzen vorhandene Ressourcen nachhaltig statt neu zu versiegeln.
Was wir wollen: Wir setzen uns für die Reaktivierung der Muldentalbahn, die Sicherung dichter Takte bei der S-Bahn Mitteldeutschland und den Ausbau der Plus-Bus-Linien ein. Rufbusse und Bürgerbusse sollen stärker gefördert werden. Zudem fordern wir ein sozial gestaffeltes Ticketmodell mit einem Mobipass für einkommensschwache Menschen.
Warum das wichtig ist: Mobilität ist Grundvoraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe, besonders im ländlichen Raum. Wer kein Auto hat, darf nicht abgehängt sein. Gleichzeitig ist der Ausbau des ÖPNV entscheidend, um die Klimaziele zu erreichen. Ein attraktiver und bezahlbarer Nahverkehr macht unseren Landkreis lebenswerter und zukunftssicher.
Was wir wollen: Wir fordern ein Landesprogramm, das historische Gebäude im ländlichen Raum für Pflegeangebote nutzbar macht – etwa für Tagespflege, Wohngemeinschaften oder generationenübergreifendes Wohnen. Fördermittel sollen Umbau, Barrierefreiheit und energetische Sanierung unterstützen.
Warum das wichtig ist: Pflege im vertrauten Umfeld steigert Lebensqualität und entlastet Angehörige. Gleichzeitig können leerstehende Höfe oder Altbauten so sinnvoll genutzt werden und Ortskerne beleben. Mit solchen Projekten stärken wir Daseinsvorsorge, regionale Identität und nachhaltige Entwicklung.
Was wir wollen: Wir stellen uns klar gegen Kürzungen in Kitas und Horten. Personelle Ausstattung darf nicht reduziert, Kündigungen müssen verhindert und das Kita-Moratorium auf Landesebene umgesetzt werden. Ziel ist ein Kita-Qualitätspaket mit langfristiger Sicherung.
Warum das wichtig ist: Frühkindliche Bildung ist das Fundament für Chancengerechtigkeit und Integration. Wer hier spart, gefährdet Zukunftschancen von Kindern und verstärkt soziale Ungleichheit. Statt Kapazitäten abzubauen, müssen wir Qualität und Verlässlichkeit verbessern – für Kinder, Eltern und Fachkräfte gleichermaßen.
Was wir wollen: Wir fordern die Streichung der gesetzlichen Einschränkung, die es Eltern aktuell nur in einem Monat erlaubt, gleichzeitig Elterngeld zu beziehen. Eltern sollen die Möglichkeit haben, selbstbestimmt zu entscheiden, wie sie die ersten Lebensmonate ihres Kindes gemeinsam gestalten und die Betreuung aufteilen.
Warum das wichtig ist: Familienmodelle sind heute vielfältig. Viele Väter möchten gerade in der ersten Zeit nach der Geburt aktiv mit einbezogen sein – die jetzige Regelung macht das praktisch unmöglich. Statt Unterstützung schafft sie Bürokratie und Druck. Eine flexiblere Gestaltung stärkt Gleichstellung, ermöglicht partnerschaftliche Erziehung und trägt dazu bei, dass Kinder von Anfang an von beiden Elternteilen intensiv betreut werden.
Was wir wollen: Wir wollen, dass Schulgründungen in freier Trägerschaft einfacher möglich werden – durch schnellere Genehmigungsverfahren, Förderprogramme, Zugang zu leerstehenden Gebäuden und bessere Vernetzung mit kommunalen Einrichtungen.
Warum das wichtig ist: Eltern im ländlichen Raum brauchen echte Wahlmöglichkeiten und gute Bildungsangebote vor Ort. Freie Schulen können dort wichtige Lücken schließen und Innovation in die Bildungslandschaft bringen. Das stärkt nicht nur Familienfreundlichkeit, sondern auch die Attraktivität ganzer Regionen.
Was wir wollen: Der Freistaat soll gezielt internationale Lehrkräfte und Lehramtsstudierende für Sachsen gewinnen, etwa durch Kooperationen mit Sprachschulen und Hochschulen im Ausland. Begleitende Programme wie Fortbildungen und Integrationshilfen sollen dafür sorgen, dass diese Lehrkräfte schnell und erfolgreich eingesetzt werden können.
Warum das wichtig ist: Der Mangel an Fremdsprachenlehrkräften gefährdet die Qualität unseres Schulsystems. Statt jahrelang auf eigene Ausbildungswege zu warten, können wir auf bewährte Fachkräfte im Ausland zurückgreifen. Das hilft nicht nur kurzfristig, die Unterrichtsversorgung zu sichern, sondern bringt auch kulturelle Vielfalt in die Schulen und stärkt interkulturelle Kompetenz – eine Schlüsselqualifikation in unserer globalisierten Welt.
Was wir wollen: Wir schlagen vor, die Wertgrenzen für Direktvergaben öffentlicher Aufträge in Sachsen auf 15.000 Euro anzuheben. Damit wird kleinen und mittleren Kommunen mehr Handlungsspielraum gegeben, Aufträge unkompliziert zu vergeben, ohne langwierige Verfahren einhalten zu müssen.
Warum das wichtig ist: Die aktuelle Bürokratie belastet gerade kleinere Verwaltungen, die ohnehin unter Personalmangel leiden. Eine praxisnahe Anhebung spart Zeit und Kosten, stärkt die Handlungsfähigkeit der Kommunen und sorgt gleichzeitig dafür, dass Aufträge schneller bei regionalen Unternehmen ankommen. Transparente Regeln verhindern Missbrauch und sichern weiterhin faire Wettbewerbsbedingungen.
Was wir wollen: Wir wollen das Sächsische Kulturraumgesetz so ändern, dass der Eigenanteil („Sitzgemeindeanteil“) für geförderte Projekte nicht mehr ausschließlich von den Kommunen getragen werden muss, sondern auch von den Zuwendungsempfängern übernommen werden kann.
Warum das wichtig ist: Viele Kommunen sind finanziell überlastet und können ihren Anteil nicht mehr aufbringen. Dadurch drohen kulturell wichtige Einrichtungen oder Projekte im ländlichen Raum wegzubrechen. Mit mehr Flexibilität sichern wir bestehende Kulturangebote, ermöglichen privaten Initiativen Engagement einzubringen und schaffen so mehr Stabilität für die kulturelle Vielfalt in ganz Sachsen.
Was wir wollen: Wir lehnen die Nutzung von Gesundheitsdaten aus der elektronischen Patientenakte oder ähnlichen Systemen für polizeiliche Zwecke kategorisch ab. Es braucht ein klares gesetzliches Verbot, und bis dieses in Kraft tritt, muss sich die SPD in Sachsen und auf Bundesebene öffentlich gegen solche Vorhaben stellen.
Warum das wichtig ist: Gesundheitsdaten gehören zu den sensibelsten Informationen überhaupt. Wenn Polizei oder Ermittlungsbehörden darauf zugreifen dürfen, ist der Vertrauensbruch enorm. Bürgerinnen müssen sicher sein können, dass ihre Gesundheitsdaten ausschließlich für medizinische Zwecke genutzt werden. Nur so bleibt das Vertrauen in Ärztinnen und das Gesundheitssystem erhalten – ein unverzichtbarer Grundpfeiler unserer Gesellschaft.
Was wir wollen: Wir unterstützen eine deutsche Bewerbung für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2040 und wollen den Landkreis Leipzig aktiv in den Bewerbungsprozess einbringen. Sportstätten wie der Kanupark Markkleeberg oder der Bockwitzer See sollen Teil des Konzepts werden.
Warum das wichtig ist: Olympia bietet die Chance, unsere Region international sichtbar zu machen, nachhaltige Infrastruktur zu schaffen und die Menschen vor Ort einzubinden. Mit klaren Prinzipien – demokratisch, nachhaltig, menschenrechtsorientiert – können Spiele entstehen, die Begeisterung wecken, aber keine Lasten hinterlassen.
Der menschengemachte Klimawandel stellt eine der größten Bedrohungen der Menschheit dar – im Landkreis Leipzig genauso wie in Afrika oder Amerika. Die gewaltigen Herausforderungen des Klimawandels erfordern eine Politik, die alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche umfasst. Damit die Folgen des Klimawandels noch beherrschbar bleiben und das 1,5-Grad-Ziel von Paris erreicht werden kann, muss jetzt dringend gehandelt werden. Die notwendigen Veränderungen in allen Lebensbereichen müssen nachhaltig sein und die ökologischen, sozialen und ökonomischen Belange ausgewogen berücksichtigen. Nur wenn wir die Überlastung unseres Planeten vermeiden und dabei auch für die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern sorgen, kann es für alle Menschen eine lebenswerte Zukunft geben. Folglich machen nötige Aktivitäten auch vor dem Landkreis Leipzig nicht halt. Im Wissen darum, dass der Kohleausstieg auch bei uns bereits deutlich vor 2038 erfolgen wird, weil die Kohle dann wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll genutzt werden kann, ist es mit einer passiven Begleitung des Strukturwandels und des Wandels der Energieversorgung nicht getan. Nötig ist eine (pro)aktive Politik, etwa bei der Bereitstellung von Dach- und Landflächen, der Beschleunigung von Planungsprozessen, der gezielten Öffentlichkeitsarbeit oder der Nutzung eigener finanzieller Mittel zum Beispiel für die Energiewende im Kleinen in Form eines Förderprogramms für Balkonkraftwerke. Die sich aus der aktuellen Entwicklung mit Blick auf Solarkraftwerke und Wasserstofferzeugung bietenden Chancen sind mit höchster Priorität zu begleiten.
Darüber hinaus zeigt sich aktuell, dass die Akzeptanz für die Energiewende überall dort besonders groß ist, wo Bürger:innen direkt von den Veränderungen profitieren. Der Landkreis und die Kommunen sollten daher gemeinsam Möglichkeiten suchen, um zum einen der Bevölkerung im Landkreis bei allen neuen Projekten Optionen zu einer direkten Beteiligung einzuräumen (möglicherweise über eine übergreifende Bürgerenergiegenossenschaft) und zum anderen alle eigenen Dach- und nutzbaren Freiflächen für eine solche lokale Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Über eine solche lokale Gesellschaft ließen sich für die Menschen im Landkreis günstige Energiepreise und eine direkte Beteiligung an möglichen Erträgen aus der Energiewende sichern.
Die fortschreitende Austrocknung der Böden machen gleich zwei weitere Anpassungen erforderlich. Wir fordern das Land und die in der Region Verantwortlichen auf, den Hochwasserschutz konsequent fortzuschreiben. Schon jetzt wissen wir, dass der bauliche Hochwasserschutz im Landkreis in verschiedenen Kommunen vor erneuten Hochwasserkatastrophen nicht ausreichend Schutz bietet. Hier ist entweder eine Verlagerung von Wohnorten oder eine weitere Einrichtung von Hochwasserschutzanlagen geboten, denn der Schutz von Leben und Eigentum der Menschen im Landkreis kann uns nicht egal sein. Zum anderen muss die kritische Fortschreibung der weiteren Entwicklung im Neuseenland erfolgen. Ob wie geplant noch viele weitere Tagebaulöcher mit Wasser verfüllt werden können, scheint aktuell eher unwahrscheinlich, hier sind Alternativen zu entwickeln.
Auch die in den letzten Jahren stark steigende Zahl an Wald- und Feldbränden ist als Indikator für die sich verändernden klimatischen Bedingungen zu werten. Diese stellen die Kommunen bei den Themen Feuerwehr und Katastrophenschutz vor schwierige Herausforderungen. Hier wollen wir uns dafür einsetzen, dass im Land Sachsen die Fördermittel und Förderquoten an die steigenden Bedarfe in den Kommunen angepasst werden.
Der Landkreis Leipzig gehört auch weiterhin zu den waldärmsten Landstrichen in Sachsen. Die Aufforstung im Landkreis Leipzig sollte auch künftig weiter forciert werden. Gerade die Waldbewirtschaftung in Form der Aufforstung ist eine Aufgabe, die erst in den nächsten Generationen wirken wird. Daher ist es umso dringlicher, jetzt mit Weitblick diese Zukunftsaufgabe anzugehen.